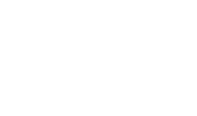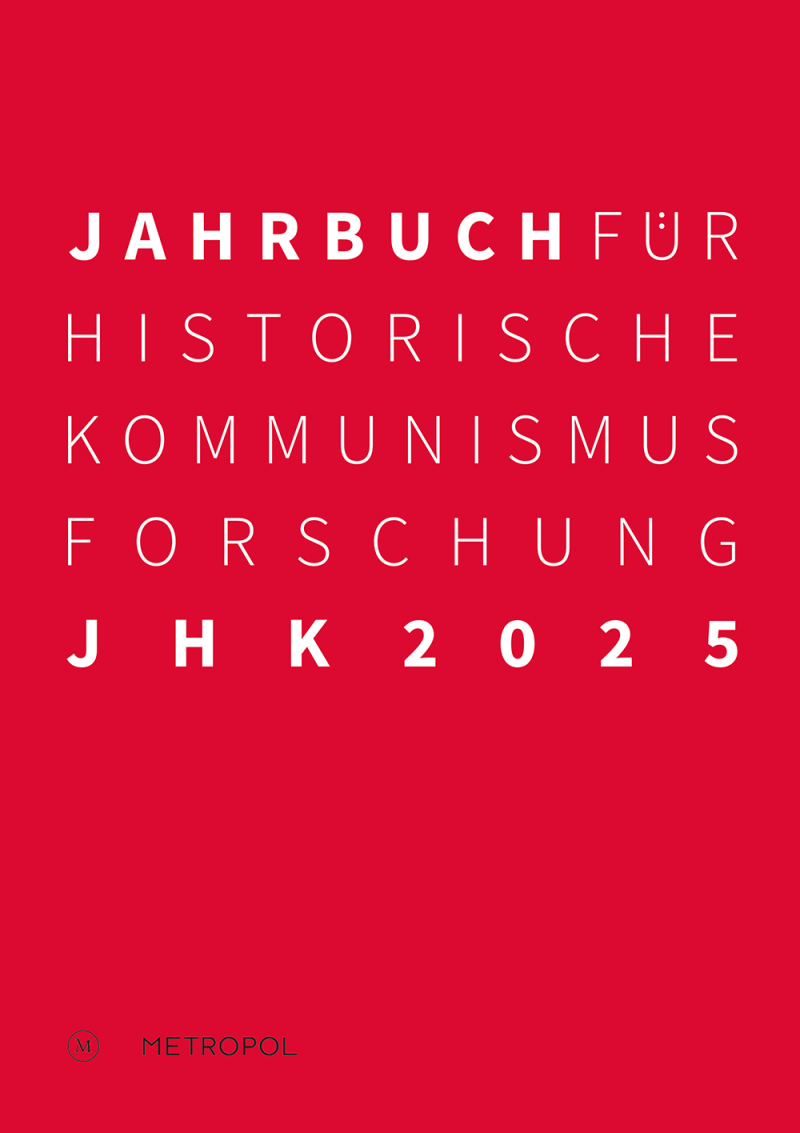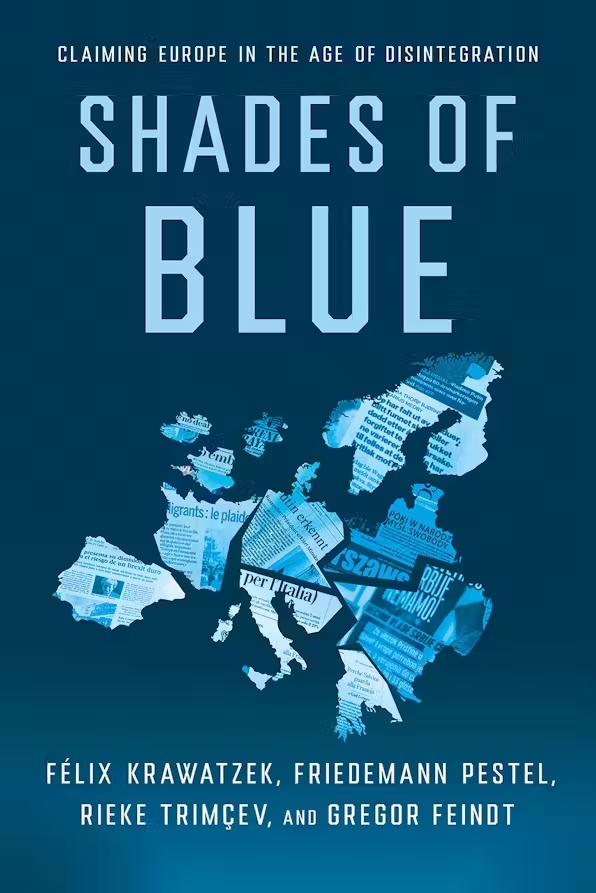Willkommen auf der Seite der Professur für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas
Théophile Féau / L'histoire par image
Willkommen auf der Seite der Professur für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas
Forschung und Lehre an der Professur widmen sich der Geschichte Europas zwischen dem späten 18. und dem 20. Jahrhundert. Westeuropa bildet einen geographischen Kern in Forschung und Lehre; die behandelten Themen enden aber nicht an seinen Grenzen. Das Untersuchungsinteresse richtet sich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede europäischer Erfahrungsräume, auf Wechselwirkungen und Austauschprozesse, über Europa hinaus auch in globaler Perspektive.